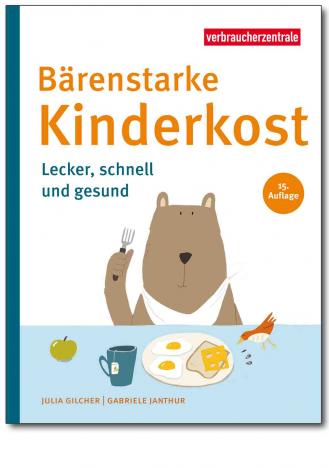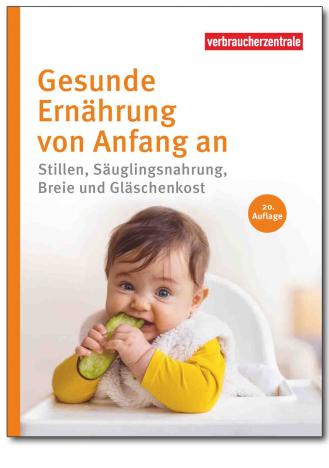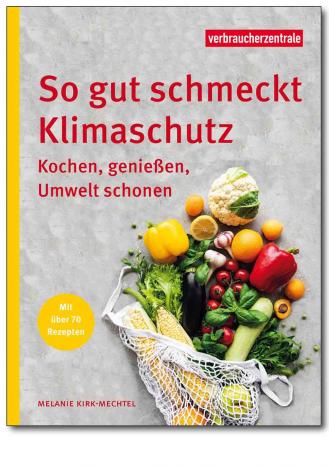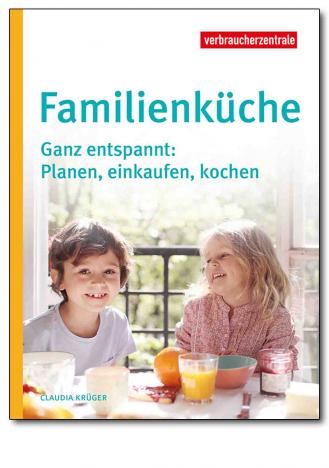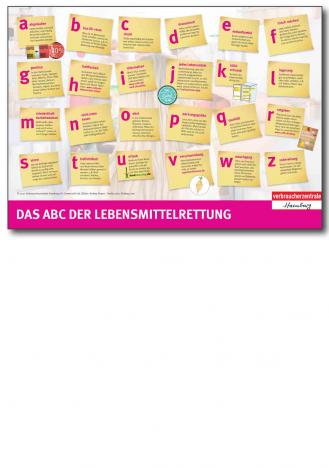Marktcheck essbare Algen: Jodquelle mit möglichem Gesundheitsrisiko

Das Wichtigste in Kürze:
- In einem bundesweiten Marktcheck untersuchten die Verbraucherzentralen 142 Produkte mit essbaren Algen.
- Konkrete Angaben zum Jodgehalt fehlten auf vielen Produkten.
- Zwei Drittel der Algenprodukte mit einem hohen Jodgehalt waren nicht ausreichend gekennzeichnet.
- Genaue Angaben zu den verwendeten Algenarten fehlten oft: Begriffe wie Meeresalgen oder Seetang sind wenig aufschlussreich.
Essbare Algen: Nahrungsquelle aus dem Wasser
Algen gelten als nachhaltige und nährstoffreiche Nahrungsquelle, die sich vielseitig verwenden lässt. Rund 1.000 Algenarten werden derzeit als Lebensmittel genutzt.
Besonders großblättrige Speisealgen und Seetang, sogenannte Makroalgen, sind in asiatischen Ländern fester Bestandteil der Küche. Auch in Europa erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit.
Spirulina und Chlorella werden vor allem in Smoothies, Nudeln oder Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt und oft als „Superfood“ beworben. Während Chlorella zu den „echten“ Algen gehört, sind Spirulina, wenn auch geläufig als Mikroalge oder auch Blaualge bezeichnet, richtigerweise Cyanobakterien.
Die Produktion von essbaren Algen nimmt weltweit stetig zu und erfolgt überwiegend in speziellen Anlagen, den „Algenfarmen“. Nur ein vergleichsweise geringer Anteil wird wild geerntet. Auch wenn Europa ein großes Wachstumspotenzial bietet, liegt die globale Algenproduktion bislang fast vollständig in China.
Ist zuviel Jod in Algen schädlich?
Algen enthalten wertvolle Nährstoffe: Protein, Omega-3-Fettsäuren und Ballaststoffe. Sie liefern darüber hinaus Mikronährstoffe wie Beta-Carotin, Vitamin B1 und Folat. Ebenso Eisen, Kalzium und Magnesium. Die gesundheitsfördernde Wirkung von enthaltenen bioaktiven Verbindungen, wie Polyphenolen, wird diskutiert.
Die Nährstoffe können sich erheblich zwischen einzelnen Algenarten unterscheiden. Selbst innerhalb einer Art sind große Schwankungen möglich. So verhält es sich auch mit dem für den menschlichen Organismus essenziellen Spurenelement Jod.
Meeresalgen reichern vergleichsweise große Mengen an Jod an. Je nach Art können sie zwischen 500 und 1.100.000 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm Trockenmasse liefern. Dabei unterliegen die Jodgehalte natürlichen Schwankungen, beeinflusst durch den Erntezeitpunkt, die Art des Gewässers, die Sonneneinstrahlung und die Wuchstiefe.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Erwachsenen täglich nicht mehr als 500 Mikrogramm Jod aufzunehmen. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sollten davon maximal 200 Mikrogramm aus Algen stammen. Diese Mengen sind bei Algenprodukten mit hohem Jodgehalt schnell erreicht.
Das BfR fordert ab einem Jodgehalt von 2.000 Mikrogramm Jod pro 100 Gramm Trockenmasse bestimmte Kennzeichnungsmaßnahmen. Algenprodukte mit hohem Jodgehalt sollten Warnhinweise tragen, die betonen, dass zu viel Jod die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen kann. Außerdem sollten der Jodgehalt sowie die maximale Verzehrmenge angegeben werden.
Jodversorgung in Deutschland
Die Jodversorgung der Bevölkerung in Deutschland ist unzureichend: Ein Drittel der Erwachsenen hat ein erhöhtes Risiko für eine unzureichende Jodversorgung. Eine ausreichende Versorgung ist jedoch wichtig, da das Spurenelement für die Bildung von Schilddrüsenhormonen benötigt wird. Hormone der Schilddrüse steuern Wachstumsprozesse, Knochenbildung, Gehirnentwicklung und den Energiestoffwechsel. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt Jugendlichen ab 13 Jahren und Erwachsenen bis unter 51 Jahren eine tägliche Jodzufuhr von 200 Mikrogramm. Für Personen ab 51 Jahren empfiehlt sie eine tägliche Jodzufuhr von 180 Mikrogramm.
Jod nehmen wir hauptsächlich über Seefisch, Milch, Eier und jodiertes Speisesalz auf. Es stellt sich die Frage, ob Meeresalgen ebenfalls den Bedarf decken können. Da es bislang keine verpflichtenden Angaben zum Jodgehalt und zur maximalen Verzehrmenge gibt, birgt eine Jodzufuhr über Algen das Risiko einer überhöhten Jodaufnahme.
Das BfR spricht bei einer einmaligen Aufnahme von über 1.000 Mikrogramm Jod von einem risikobehafteten "Jodexzess". Besonders jodreiche Algen können solche hohen oder noch höhere Mengen enthalten. Langfristig sollten über Algen nicht mehr als 200 Mikrogramm Jod pro Tag aufgenommen werden.
Ergebnisse des Marktchecks
Unter den 142 erfassten Produkten aus und mit Algen identifizierten die Verbraucherzentralen 56 Produkte, die aufgrund des hohen Jodgehalts einen Warnhinweis tragen sollten. Ebenso wünschenswert wären Angaben zum Jodgehalt und der dazugehörigen maximalen Verzehrmenge. Bei zwei Drittel dieser Produkte war die Kennzeichnung unvollständig oder fehlte ganz. Lediglich 18 der 56 Produkte trugen alle Angaben.
Auf jodreichen Algenprodukten unerlässlich:
- Warnhinweis bei Produkten mit jodreichen Algen
- Angabe zum Jodgehalt in der Nährwertdeklaration
- Angabe zur maximalen täglich empfohlenen Verzehrmenge
- konkrete Angaben zur mengenmäßigen Verwendung mit Angabe und ggf. einer Anleitung zur Portionierung (beispielsweise 1 TL)
- Hinweise zur Zubereitung
Werbung mit der Aussage „reich an Protein“
Über 40 Prozent der Produkte trugen nährwertbezogene Angaben wie „reich an Protein“. Dies könnte Käuferinnen und Käufer dazu verleiten, dass sie mehr davon konsumieren. Makroalgen sollten aufgrund ihres meist hohen Jodgehaltes nur in vergleichsweise geringen Mengen verzehrt werden. Dann leisten sie keinen nennenswerten Beitrag zur Proteinaufnahme. Jod-arme Mikroalgen, wie Chlorella, enthalten zwar bis zu 65 Prozent Proteinanteil in der Trockenmasse, doch zur Deckung des täglichen Bedarfs von 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht wären ebenfalls unrealistisch große Verzehrmengen erforderlich.
Werbung mit Begriffen wie „Regeneration“ oder „Energie“
Teilweise warben die Algenprodukte mit unzulässigen gesundheitsbezogenen Angaben, beispielsweise die vagen Begriffe „Regeneration“ oder „Energie“ bei Getränken mit Algenzusatz. Lassen Sie sich davon nicht täuschen: Solche irreführenden Aussagen sind rechtlich unzulässig.
„Meeresalgen“ oder „Seetang“ sagt nichts über die Algenart aus
Bei etwa jedem fünften Produkt blieb die verwendete Algenart unklar. Stattdessen waren allgemeine Bezeichnungen wie „Meeresalgen“ oder „Seetang“ angegeben. Hersteller sollten jedoch zumindest den geläufigen Namen der im Lebensmittel verwendeten Algenart deklarieren.
Algenanteil häufig unklar
Der Anteil an Algen wurde bei über der Hälfte der Produkte nicht angegeben. Die Spannbreite ist je nach Produkttyp groß: Während Monoprodukte häufig vollständig aus Algen bestehen, lag der gekennzeichnete Anteil bei Snacks und Convenience-Produkten zwischen 0,2 Prozent und 86 Prozent.
Kritische Inhaltsstoffe in Speisealgen
Algen können Schwermetalle wie Cadmium, Blei und Kupfer enthalten sowie Arsen und Aluminium anreichern. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) konnte teils hohe Werte in getrockneten Meeresalgen nachweisen.
Je nach Produktionssystem und Algenart können weitere kritische Inhaltsstoffe hinzukommen, unter anderem polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe oder Mikrocysteine.
Potenziale und ökologische Herausforderungen von Algen
Algen bieten enormes Potenzial: als Nahrungsmittel, Biokraftstoff oder in Kosmetikprodukten und Arzneimitteln. Gleichzeitig sind mit ihrem Anbau und ihrer Nutzung ökologische Herausforderungen verbunden.
Algen und Cyanobakterien (zum Beispiel Spirulina) produzieren einen großen Teil des lebenswichtigen Sauerstoffs und können große Mengen CO2 binden. Allerdings entsteht bei Ernte, Transport und Verarbeitung ebenfalls CO2. Die Klimabilanz hängt daher von der Effizienz und Nachhaltigkeit der Produktion ab, weshalb Werbeaussagen zur Klimafreundlichkeit kritisch hinterfragt werden sollten.
Mikroalgen zeichnen sich durch eine hohe Nährstoffdichte und nahezu vollständige Verwertbarkeit aus. Sie benötigen deutlich weniger Fläche als herkömmliche Landpflanzen und können auch in Industriehallen, offenen Becken oder Photobioreaktoren kultiviert werden. Ihr schnelles Wachstum ermöglicht hohe Erträge. Allerdings kann der Anbau je nach Methode zur Wasserverschmutzung beitragen, Ökosysteme stören und Wildalgenbestände gefährden.
Laut Lebensmittelhygiene-Verordnung müssen Algen für den menschlichen Verzehr sicher sein. Während es für konventionell erzeugte Algen keine spezifischen Vorgaben für ihre Kultivierung und Ernte gibt, sind diese für Bio-Algen in der EU-Öko-Verordnung geregelt. So muss beispielsweise die Ernte, neben anderen Bestimmungen, nachhaltig erfolgen, um Bestände zu schonen und das Ökosystem nicht zu schädigen.
Tipps: Algen sicher verzehren
- Jodgehalt beachten: Achten Sie auf den Jodgehalt von Algenprodukten, besonders wenn diese hohen Konzentrationen von Jod (über 2.000 Mikrogramm pro 100 Gramm Lebensmittel) enthalten. Zu viel Jod kann gesundheitsschädlich sein. Werden bei Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt an Meeresalgen keine Angaben zum Jodgehalt gemacht, sollten Sie auf die Verwendung verzichten.
- Verzehrmenge einhalten: Beachten Sie die Verzehrmengenempfehlung auf der Verpackung, wie „max. 1,7 g getrocknete Meeresalgen pro Tag“. Einige Hersteller geben praxisnahe Vergleiche, beispielsweise „ca. 1 g = 1 TL getrocknete Algen“, um die Mengen besser verständlich zu machen.
- Zubereitungshinweise befolgen und Portionsangaben berücksichtigen: Beachten Sie die Informationen zur Zubereitung, wie Einweichvorgang, Kochzeit und -temperatur.
- Personen mit Schilddrüsenerkrankungen sollten ihre Jodaufnahme besonders im Blick behalten und ärztlichen Rat einholen.